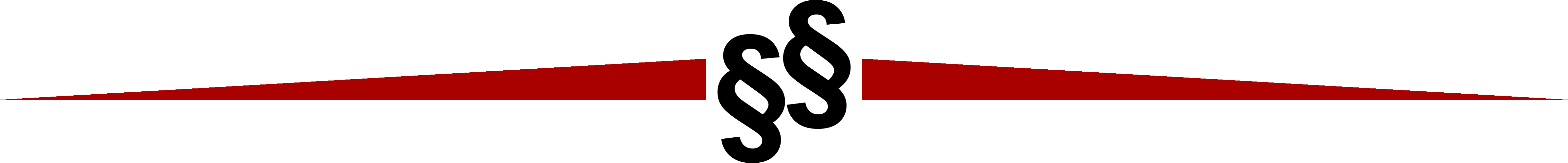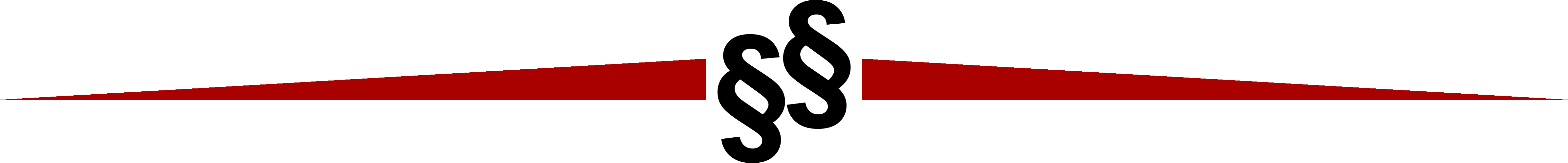Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Mandanteninformationen. Wenn Sie recherchieren oder ältere Ausgaben betrachten möchten, können Sie hier unser Archiv aufrufen.
- Aufgabenfeld entscheidet: Vier Monate Probezeit können für eine auf zwölf Monate befristete Anstellung angemessen sein
Eine Zusammenarbeit auf Probe kann so lange andauern, wie es das jeweilige Aufgabenfeld oder aber die Position erfordern, um beiderseits sicherzugehen: "Das passt mit uns." Das Bundesarbeitsgericht (BAG) musste entscheiden, ob die Probezeit bei dem hier befristeten Arbeitsvertrag zu lang angesetzt war. Denn laut Arbeitgeber passte die Angestellte auf Probe eben nicht zum Unternehmen. Ob der Kündigungsschutz nun bereits galt oder eben nicht, war der springende Punkt für die Gekündigte.
Die Angestellte wurde ab dem 22.08.2022 für ein Jahr im Kundenservice angestellt. Beide Seiten legten fest, dass die ersten vier Monate als Probezeit gelten sollten und in dieser Zeit mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden dürfe. Am 10.12.2022 erhielt die Beschäftigte ein Schreiben, in dem das Unternehmen das Arbeitsverhältnis zum 28.12. beenden wollte. Die Betroffene hielt diese Frist für falsch und die Probezeit für zu lang. Sie meinte, auch in ihrem Fall müsse die normale gesetzliche Kündigungsfrist gelten. Außerdem vertrat sie die Ansicht, dass eine unwirksame Probezeitregel die Kündigung während der Befristung insgesamt erschweren könne und daher das Kündigungsschutzgesetz bereits greifen müsse.
Das BAG stellte jedoch klar, dass es keine feste Vorgabe für die Länge einer Probezeit gebe. Entscheidend sei immer, wie lange die Befristung dauere und welche Aufgaben erlernt werden müssten. Im konkreten Fall lag ein Einarbeitungskonzept vor, das drei Lernstufen über insgesamt 16 Wochen vorsah. Da die Probezeit genau diesem Zeitraum entsprach, hielt das Gericht jene vier Monate auch für angemessen. Es erklärte außerdem, dass selbst eine zu lang bemessene Probezeit nichts daran ändern würde, dass die gesetzliche Wartezeit von sechs Monaten für den allgemeinen Kündigungsschutz weiterhin gilt. Die Kündigung musste daher auch nicht besonders begründet werden. Am Ende bestätigte das höchste Gericht in Sachen Arbeitsrecht, dass das Arbeitsverhältnis fristgerecht beendet worden war und die Einwände der Beschäftigten somit nicht griffen.
Hinweis: Wer befristete Verträge nutzt, sollte die Probezeit nachvollziehbar planen. Eine saubere Begründung verhindert Streit über Kündigungsfristen. Doch selbst bei Fehlern in der Probezeitklausel bleibt die gesetzliche Wartezeit unverändert.
Quelle: BAG, Urt. v. 30.10.2025 - 2 AZR 160/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- BAG senkt Hürden: Bereits ein einzelner Gehaltsvergleich kann Ungleichbehandlung vermuten lassen
Die Tatsache, dass hierzulande nur ungern über den Verdienst geredet wird und Arbeitgeber gern versuchen, den entsprechenden Austausch unter Kollegen zu verhindern, macht es schwer, sich gegen eine vermutete Ungleichbehandlung zu wehren. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nun die Hürden herabgesetzt, die es für eine darauf ausgerichtete Klage zu überwinden gilt. Es stellte mit der kürzlich ergangenen Entscheidung klar, welche Anforderungen es an einen sogenannten Paarvergleich stellt.
In einem Unternehmen forderte eine Beschäftigte rückwirkend mehr Geld, weil sie meinte, für gleiche oder zumindest gleichwertige Aufgaben schlechter bezahlt worden zu sein als ihre männlichen Kollegen. Dabei stützte sie sich auf interne Zahlen aus einem gesonderten Informationsbereich, der Einblicke in Gehaltsstrukturen bot. Diese Daten zeigten auf, dass die ausgewählten Männer über dem mittleren Einkommen ihrer Ebene lagen. Das Unternehmen widersprach und erklärte, die Vergleichspersonen hätten andere Tätigkeiten ausgeübt, so dass ein direkter Vergleich unzulässig sei. Außerdem behauptete der Arbeitgeber, die Beschäftigte habe schwächere Leistungen erbracht, was ihren niedrigeren Lohn erkläre. Das Landesarbeitsgericht (LAG) folgte dieser Sicht weitgehend und meinte, ein einzelner männlicher Kollege reiche allein nicht aus, um eine Vermutung für eine Benachteiligung auszulösen. Wegen der geringen Größe der Vergleichsgruppe und abweichender Medianwerte sah das LAG keinen hinreichenden Hinweis auf eine Ungleichbehandlung, sprach aber für kleinere Vergütungsbestandteile eine Ausgleichszahlung zu.
Das BAG hob diese Entscheidung des LAG auf und betonte, dass keine hohen Hürden für Entgeltgleichheit gelten dürfen. Es reiche aus, wenn eine Frau zeigen könne, dass ein einzelner Mann bei gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit mehr erhalte. Die Größe der Gruppen oder unterschiedliche Durchschnittswerte spielten für die Vermutung keine Rolle. Entscheidend sei allein, dass eine konkrete Vergleichsperson existiere, die besser bezahlt werde. Da das LAG falsche Maßstäbe angewandt hatte, müsse es den Fall erneut prüfen und klären, ob der Arbeitgeber den Verdacht durch sachliche Gründe entkräften könne.
Hinweis: Dieses Urteil stärkt Schutz vor Entgeltungleichheit deutlich. Bereits ein einzelner Vergleich genügt, um den Verdacht einer Ungleichbehandlung auszulösen. Unternehmen müssen dann nachvollziehbar erklären, warum derlei Differenzen bestehen.
Quelle: BAG, Urt. v. 23.10.2025 - 8 AZR 300/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- EuGH bestimmt Ablauf: Kündigungen sind bei größeren Entlassungsmaßnahmen nur mit richtiger Meldung wirksam
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) befasste sich mit der Frage, wann Kündigungen in größeren Entlassungswellen wirksam werden und welche Folgen eine fehlende oder fehlerhafte Meldung an die zuständige Behörde hat. Dazu legte es dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) den Fall vor. Dieser traf eine Entscheidung, indem er die hierfür notwendigen Abläufe klar festlegte.
Anlass für diese Klärung gab ein Fall vor dem BAG, bei dem ein langjähriger Beschäftigter einer GmbH nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens seinen Arbeitsplatz verloren hatte. Der Insolvenzverwalter hatte das Arbeitsverhältnis bereits am Tag nach der Verfahrenseröffnung gekündigt, nachdem zuvor schon mehrere Kolleginnen und Kollegen die Firma verlassen mussten. Dadurch lag also eine geplante größere Entlassung vor, und eine solche hätte eine vorherige Meldung bei der Arbeitsbehörde nötig gemacht. Da diese Meldung aber fehlte, verlangte der Beschäftigte die Feststellung, dass seine Kündigung unwirksam gewesen sei.
Der EuGH entschied, dass eine Kündigung in solchen Fällen frühestens 30 Tage nach Eingang einer vollständigen und rechtzeitigen Anzeige wirksam werden durfte. Die Frist starte nur dann, wenn alle notwendigen Angaben vorliegen; eine später nachgereichte Meldung beseitigte den ursprünglichen Fehler nicht. Der vorgeschriebene Ablauf besteht demnach aus Beratung der Arbeitnehmervertretung, danach aus der Meldung bei der Behörde und erst dann aus dem Ablauf der Frist. Eine bereits ausgesprochene Kündigung könne nicht im Nachhinein wirksam gemacht werden. Der EuGH stellte zudem in einem anderen Fall klar, dass fehlende Informationen - etwa zu Gesprächen mit der Interessenvertretung - den Zweck der Meldung nicht erfüllen. Auch eine einfache Eingangsbestätigung der Behörde änderte in diesem Fall daran nichts. Selbst eine unvollständige Anzeige setzte die 30-Tage-Frist nicht automatisch in Gang, da die Richtlinie für Verstöße andere Durchsetzungsmöglichkeiten vorsah.
Hinweis: Ohne eine vollständige Meldung kann eine Kündigung im Rahmen größerer Entlassungen nicht wirksam werden. Fehler können nicht nachträglich geheilt werden. Unvollständige Angaben lösen die gesetzliche Frist nicht aus.
Quelle: EuGH, Urt. v. 30.10.2025 - C-134/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- Ganz oder gar nicht: Arbeitnehmer müssen Sonderzahlungen bei nur teilweisen Tarifverweisen nicht zurückzahlen
Ein Arbeitgeber bestand auf die Einhaltung einer Klausel, die der klagende Arbeitgeber einst mit seiner Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag abgesegnet hatte und die auf einen Reformtarifvertrag verwies. Problem war nur, dass es sich beim Arbeitgeber um einen nicht tarifgebundenen Betrieb handelte. Ob diese Form der Rosinenpickerei arbeitsrechtlich überhaupt möglich ist, musste final das Bundesarbeitsgericht (BAG) klären.
Ein Rettungssanitäter arbeitete seit 2020 in einem nicht tarifgebundenen Betrieb, dessen Arbeitsvertrag jedoch bestimmte, dass der Reformtarifvertrag des Deutschen Roten Kreuzes gelten sollte. Darin stand, dass eine Sonderzahlung zurückgegeben werden müsse, wenn jemand aus persönlichen Gründen spätestens bis zum 31.03. des Folgejahres ausscheide. Für November 2021 erhielt der Beschäftigte eine Sonderzahlung von 2.767,19 EUR brutto. Am 19.01.2022 kündigte er sein Arbeitsverhältnis zum Ende März, was die Geschäftsführung bestätigte und zugleich ankündigte, den Bonus zurückzufordern. In den folgenden drei Monaten zog das Unternehmen mehrere Teilbeträge vom Nettolohn des Rettungssanitäters ab. Dieser akzeptierte die Abzüge nicht und verlangte die volle Auszahlung seines Gehalts. Er argumentierte, dass er erst am 31.03. ausschied und die Tarifregel deshalb nicht griff. Außerdem hielt er die Klausel für eine unfaire Vertragsgestaltung.
Das BAG entschied, dass der Beschäftigte die Sonderzahlung in der Tat nicht zurückgeben musste, weil dem Unternehmen eine wirksame Grundlage für seine Forderung fehlte. Die tarifliche Regel hielt der rechtlichen Überprüfung nicht stand, da sie Beschäftigte unangemessen benachteiligte und damit unwirksam war. Zwar unterliegen Tarifverträge normalerweise nicht dieser Kontrolle, jedoch galt dies hier nicht, weil der Tarifvertrag nur teilweise in den Arbeitsvertrag übernommen worden war. Das BAG stellte daher klar, dass nur vollständig übernommene Tarifverträge vor einer Inhaltskontrolle geschützt seien. Werden dagegen nur einzelne Teile übernommen, können diese wie gewöhnliche Vertragsklauseln geprüft werden.
Hinweis: Teilweise übernommene Tarifregeln können unwirksam sein. Rückzahlungsforderungen sollten deshalb genau geprüft werden, da Sonderzahlungen nicht automatisch zurückgegeben werden müssen, nur weil der Vertrag das aussagt.
Quelle: BAG, Urt. v. 02.07.2025 - 10 AZR 162/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- Von "ordentlich" zu "fristlos": Falsche Angaben in Kündigungsschutzklage können zur sofortigen Kündigung führen
Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen (LAG) befasste sich mit einer interessanten Frage: Kann das Fälschen eines Schriftstücks zur fristlosen Kündigung führen, wenn selbst das Original nicht geeignet wäre, den begehrten Anspruch dem Arbeitgeber gegenüber durchzusetzen? Im Gegensatz zu den vorinstanzlichen Kollegen legte es bei der Beantwortung der Frage seinen Schwerpunkt darauf, wie schwer ein solches Verhalten rechtlich wiegt.
Ein E-Bike-Händler beschäftigte seinen Mitarbeiter seit 2016. Der langjährige Angestellte leitete im Verlauf der langen Zusammenarbeit schließlich auch eine Filiale. Dann stellte das Unternehmen bei zwei Inventuren Ende 2023 erhebliche Fehlbestände fest, von denen ein Teil ungeklärt blieb. Anfang 2024 sollte der Beschäftigte schließlich darlegen, wie diese Lücken entstanden sein könnten. Er wurde zugleich auf mögliche Unregelmäßigkeiten angesprochen und erhielt noch am selben Tag die ordentliche Kündigung. Der Angestellte zog dagegen vor Gericht und verlangte eine Bonuszahlung von 10.000 EUR. Als Beleg für diesen Anspruch legte er ein Dokument vor, das wie ein alter Vertrag wirkte, aber keine Arbeitgeberunterschrift enthielt. Prompt folgte am 21.02.2024 die fristlose Kündigung. Das Arbeitsgericht hielt diese jedoch für ungerechtfertigt, weil es keine Pflichtverletzung erkennen wollte und den eingereichten Vertrag nicht als tauglichen Beleg ansah. Schließlich sei ein von Arbeitgeberseite nicht unterschriebenes Schriftstück gar nicht geeignet, einen Anspruch durchzusetzen.
In der Berufung kam das LAG jedoch zu einem anderen Ergebnis. Nach seiner Bewertung durfte das Arbeitsverhältnis sofort beendet werden, weil das Verhalten des Beschäftigten so schwer wog, dass ein Abwarten der Kündigungsfrist arbeitgeberseitig als unzumutbar erschien. Das Gericht wertete die bewusst falsche Darstellung im Prozess als schweren Verstoß gegen die Pflicht zur Rücksichtnahme. Wer im Verfahren Tatsachen erfindet, um sich Vorteile zu verschaffen, überschreitet aus Sicht des LAG eine klare Grenze. Der eingereichte, nicht unterschriebene Vertrag sollte seiner Einschätzung nach gezielt einen Anspruch vortäuschen.
Hinweis: Unwahre Tatsachenbehauptungen in einem Rechtsstreit können arbeitsrechtlich gravierende Folgen haben. Wer absichtlich falsche Grundlagen schafft, gefährdet nach dieser Entscheidung seinen Arbeitsplatz. Auch im Streit gilt, dass nur echte und überprüfbare Angaben verwendet werden dürfen.
Quelle: LAG Niedersachsen, Urt. v. 13.08.2025 - 2 SLa 735/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- Europäisches Nachlasszeugnis: Gericht darf offensichtliche Einwände selbst prüfen
Ein Europäisches Nachlasszeugnis dient dazu, dass Erben ihre Erbenstellung im europäischen Ausland nachweisen können. Das Nachlassgericht hatte hier den Antrag der Tochter einer Verstorbenen auf ein solches Dokument abgelehnt, weil ein Sohn der Erblasserin dem widersprochen hatte. In dem darauffolgenden Verfahren ging es nun darum, ob ein solches Zeugnis trotz des Einwands eines Miterben ausgestellt werden kann. Das Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) war gefragt.
Die Erblasserin hatte mit ihrem bereits 2001 verstorbenen Ehemann im Jahr 2000 ein gemeinschaftliches Testament verfasst. Darin setzten sich beide gegenseitig als Vorerben ein, die drei gemeinsamen Kinder sollten später alles gemeinsam erhalten. Das Testament enthielt Formulierungen, die darauf hindeuten, dass die Kinder nicht nur für den ersten Erbfall, sondern letztlich auch für den Nachlass des länger lebenden Ehegatten bestimmt waren. Die Ehefrau verfasste 2005 allerdings ein weiteres Testament, in dem sie zwei ihrer Kinder als Alleinerben einsetzte und die anderen beiden vollständig von der Erbschaft ausschloss. Nach dem Tod der Mutter beantragte die Tochter, die im Jahr 2005 enterbt worden war, ein Europäisches Nachlasszeugnis. Sie berief sich darauf, dass das frühere gemeinschaftliche Testament bindend sei und die spätere Enterbung deshalb keine Wirkung habe. Einer ihrer Halbbrüder widersprach dem Antrag jedoch und behauptete, selbst erbberechtigt zu sein, weil er der leibliche Sohn der Erblasserin sei. Das Nachlassgericht lehnte den Antrag auf Erteilung des Nachlasszeugnisses ab. Das Gericht war der Ansicht, sobald irgendein Beteiligter Einwände erhebe, dürfe das Zeugnis nicht ausgestellt werden - selbst wenn der Einwand möglicherweise falsch sei. Die Tochter legte dagegen Beschwerde ein.
Das OLG gab ihr Recht, denn in der Sache selbst hielt es die spätere Enterbung für unwirksam. Das gemeinschaftliche Testament von 2000 sei so auszulegen, dass die gemeinsamen Kinder nicht nur für den ersten Erbfall, sondern auch für den Nachlass des zuletzt verstorbenen Elternteils eingesetzt waren. Die Formulierungen im Testament zeigten nach Ansicht des Gerichts deutlich, dass die Eheleute ihr gesamtes Vermögen den gemeinsamen Kindern zukommen lassen wollten. Dadurch war die Ehefrau gebunden und konnte die Regelung nicht einseitig ändern. Der widersprechende Sohn ist daher nicht Erbe geworden. Entscheidend für die Aufhebung und für die Zurückverweisung der Angelegenheit an das Nachlassgericht war aber ein weiterer Punkt: Das OLG stellte klar, dass ein Beschwerdegericht - anders als das Nachlassgericht - bestimmte Einwände selbst prüfen darf. Das gilt zumindest dann, wenn sich diese allein anhand der Akten klären lassen - wenn also keine weiteren Ermittlungen nötig sind. Andernfalls könnte ein Beteiligter das Verfahren schlicht dadurch blockieren, dass er unbegründete Einwände erhebt. Dies würde dem Zweck des Europäischen Nachlasszeugnisses widersprechen, das grenzüberschreitende Erbfälle schnell und unkompliziert handhabbar machen soll. Das Nachlassgericht muss den Antrag nun unter Berücksichtigung der Hinweise des Beschwerdegerichts neu bewerten.
Hinweis: Ein gemeinschaftliches Testament kann Eheleute dauerhaft binden. Wenn Regelungen wechselseitig getroffen wurden - etwa zugunsten der gemeinsamen Kinder -, kann der länger lebende Ehegatte diese später nicht einfach ändern. Ob eine Bindung vorliegt, ergibt sich oft aus der Auslegung des Testaments und aus Formulierungen, die den gemeinsamen Willen erkennen lassen.
Quelle: OLG Karlsruhe, Beschl. v. 08.10.2025 - 14 W 81/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- Formvorschrift erfüllt: Handschriftliches Testament mit nummerierten Anlagen ist wirksam
Ein handschriftliches Testament muss eigenhändig geschrieben und insbesondere unterschrieben sein. Ob sich die Unterschrift zwingend auf jeder Seite eines mehrseitigen Schriftstücks befinden muss - das zudem nicht zu einem Zeitpunkt, sondern über mehrere Jahre entstanden ist -, war die Frage des folgenden Erbrechtsfalls. Das Landgericht Frankenthal (LG) sah sich die Sachlage an und fand schließlich eine schlüssige Antwort.
In dem Verfahren stritt ein Neffe des Erblassers mit einem Vermächtnisnehmer darüber, ob ein im Testament vorgesehenes Vermächtnis über 20.000 EUR wirksam ist. Der Neffe wollte als Alleinerbe gerichtlich feststellen lassen, dass der Freund des Erblassers keinen Anspruch auf diesen Betrag hat. Der Erblasser hatte 2011 ein Testament errichtet und dort bezüglich der genauen Verteilung von Geldzuwendungen an Patenkinder, Verwandte und enge Vertraute auf eine Anlage zum Testament verwiesen. Das Testament selbst war vollständig handschriftlich verfasst und vom Erblasser unterschrieben. Die Anlagen, insgesamt vier Stück, hatte er ebenfalls handschriftlich verfasst, unterschrieben hatte er sie aber nicht. Sie entstanden teilweise erst Jahre nach dem ursprünglichen Testament. Der Erblasser gab sowohl das Testament als auch alle Anlagen gemeinsam und einheitlich zur amtlichen Verwahrung. Der Neffe hielt diese Anordnung für formunwirksam, weil der Erblasser die Anlage nicht unterschrieben hatte, und berief sich auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wonach ein Testament nicht durch bloße Bezugnahme auf eine nicht formgerecht errichtete Anlage ergänzt werden kann.
Das LG folgte dieser Auffassung jedoch nicht und stellte fest, dass der Erblasser die Anlagen selbst vollständig handschriftlich geschrieben und bereits im Testamentstext ausdrücklich auf sie verwiesen hatte. Damit bildeten Testament und Anlagen sowohl inhaltlich als auch funktional eine Einheit. Entscheidend sei, dass der Erblasser seinen gesamten letzten Willen auf mehreren Blättern festgelegt hatte, die alle von ihm stammten und zusammengehörten. Die Unterschrift unter dem Testament deckte nach Ansicht des Gerichts den gesamten, aus mehreren Teilen bestehenden Text ab. Das LG betonte zudem, dass es für die Wirksamkeit eines privatschriftlichen Testaments nicht darauf ankäme, ob alle Teile in einem Zug entstanden sind oder wie der Erblasser sie bezeichnet hat. Auch spiele es keine Rolle, dass einige Anlagen zeitlich erst Jahre nach dem Haupttext entstanden seien. Wichtig sei allein, dass der Erblasser die Teile als ein zusammengehöriges Gesamtwerk verstanden hatte - und dafür spräche hier sowohl der Aufbau des Testaments als auch die Abgabe aller Schriftstücke in gemeinsamer Verwahrung. Die Klage des Neffen wurde vom LG abgewiesen.
Hinweis: Bei einem handschriftlichen Testament muss laut LG nur der gesamte letzte Wille unterschrieben sein - nicht jedes einzelne Blatt. Verweist der Erblasser im Testament ausdrücklich auf weitere von ihm handschriftlich verfasste Seiten, können diese auch ohne eigene Unterschrift wirksamer Teil des Testaments werden. Entscheidend ist, dass sich aus den Umständen ergibt, dass alle Teile zusammen eine einzige letztwillige Verfügung bilden.
Quelle: LG Frankenthal, Urt. v. 21.10.2025 - 8 O 116/25(aus: Ausgabe 01/2026)
- Nachlasspflege und Inflation: Stundensatz kann wegen erheblich gestiegener Kosten angepasst werden
Die Kosten eines Nachlasspflegers sind aus dem Nachlass zu bestreiten, weshalb die Frage, in welcher Höhe die Kosten entstanden sind, für die Erben von großem Interesse ist. Die Frage, die vor dem Oberlandesgericht Nürnberg (OLG) hierzu verhandelt wurde, war, wie hoch die Vergütung eines berufsmäßigen Nachlasspflegers sein darf. Eins zumindest war klar: Auch vor dieser Berufsgruppe macht die Inflation nicht Halt.
Ein Rechtsanwalt war vom Amtsgericht eingesetzt worden, um unbekannte Erben zu ermitteln und den Nachlass eines Verstorbenen zu sichern und zu verwalten. Für seine Tätigkeit von Ende 2023 bis Ende 2024 verlangte er eine Vergütung auf Basis eines Stundensatzes von 130 EUR netto. Das Nachlassgericht hielt hingegen nur 110 EUR für angemessen. Dagegen legte der Nachlasspfleger erfolgreich Beschwerde ein.
Das OLG stellte zunächst klar, dass Nachlasspfleger ihre Vergütung nicht nach festen Tabellen erhalten. Entscheidend seien vielmehr ihre fachlichen Fähigkeiten sowie Umfang und Schwierigkeit der Aufgaben. Für Rechtsanwälte, die einen nicht mittellosen Nachlass verwalten, galt im Oberlandesgerichtsbezirk bislang ein Satz von 110 EUR netto als Richtwert. Dieser Satz müsse jedoch auch an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst werden. Das Gericht verwies daher auch auf die erheblich gestiegenen Kosten seit der früheren Entscheidung aus dem Jahr 2021. Die allgemeine Inflation von 16,7 % habe auch die Betriebskosten eines Rechtsanwalts deutlich erhöht, insbesondere in einem Ballungsraum wie Nürnberg. Schon dadurch ergäbe sich rechnerisch ein Stundensatz von rund 128 EUR. Hinzu käme, dass der Gesetzgeber in verwandten Bereichen die Vergütungen bereits angehoben hatte: Die Stundensätze für Vormünder wurden seit 2023 um bis zu 18 % erhöht und die Honorare für bestimmte gerichtliche Sachverständige wurden ebenfalls bereits mehrfach angehoben. Diese Entwicklungen zeigten nach Ansicht des Gerichts, dass eine Anpassung auch für Nachlasspfleger sachgerecht sei. Deshalb setzt das OLG den Stundensatz ab Januar 2024 mit 130 EUR netto an. Für die vom Pfleger nachgewiesenen rund 39 Arbeitsstunden ergäbe das eine Vergütung von gut 6.000 EUR brutto, die vollständig aus dem Nachlass zu zahlen ist.
Hinweis: Die Vergütung berufsmäßiger Nachlasspfleger richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Steigen Kosten und gesetzliche Vergleichswerte über längere Zeit deutlich an, kann auch der Stundensatz im Nachlasspflegerecht angepasst werden. Entscheidend bleibt, dass der Einsatz qualifizierter Fachkräfte dem Wert und der Komplexität des Nachlasses angemessen ist.
Quelle: OLG Nürnberg, Beschl. v. 24.10.2025 - 15 Wx 711/25(aus: Ausgabe 01/2026)
- Objektive Umstände nötig: Keine Vermögenssicherung des Pflichtteilsberechtigten durch einen Arrest
Mithilfe eines sogenannten Arrests kann ein Gläubiger zur Sicherung einer Geldforderung das Vermögen des Schuldners - beispielsweise Immobilienvermögen - vorübergehend "einfrieren" lassen, um einer drohenden Verschiebung dieser Vermögenswerte entgegenzuwirken. Ein solcher Arrestanspruch war Gegenstand eines Rechtsstreits eines Pflichtteilsberechtigten gegenüber einer Erbin vor dem Oberlandesgericht Brandenburg (OLG).
Der Sohn des Erblassers verlangte von der Alleinerbin - der Ehefrau des Verstorbenen - seinen Pflichtteil. Ein wesentlicher Teil des Vermögens bestand aus landwirtschaftlichen Grundstücken, die bereits Jahre vor dem Erbfall auf eine Tochter übertragen worden waren. Der Sohn war der Ansicht, dass für diese Übertragung die Zustimmung der Ehefrau notwendig gewesen sei, die aber beim Tod des Erblassers nicht vorgelegen habe. Hierdurch befürchtete der Sohn, dass sein Pflichtteil verkürzt werden könne. Mithilfe des Arrests wollte er erreichen, dass die Grundstücke nicht anderweitig übertragen werden können, bis die Pflichtteilsansprüche ermittelt sind.
Wie zuvor bereits die Vorinstanz - das Landgericht - wies nun auch das OLG den Antrag zurück. Beide Gerichte stellten klar, dass der Pflichtteilsberechtigte gegenüber der Tochter des Erblassers keinen geeigneten Anspruch habe, der durch einen Arrest gesichert werden könne. Der Sohn habe keine konkreten erbrechtlichen oder sonstigen Ansprüche dargelegt, weshalb es an einem Anspruch fehle, der vorläufig gesichert werden konnte. Gegenüber der Witwe als Alleinerbin sei der Sohn zwar grundsätzlich pflichtteilsberechtigt. Dies genüge aber nicht für einen Arrestanspruch. Die allgemeine Sorge, dass er Ansprüche später nicht mehr vollstrecken könne, reichten für einen Arrest nicht aus. Es müssen vielmehr objektive Umstände vorliegen, die eine solche Gefahr nahelegen - und derartige Umstände konnten in beiden Instanzen nicht festgestellt werden.
Hinweis: Das OLG stellte im Übrigen auch klar, dass die familienrechtliche Notwendigkeit zur Zustimmung in einer Zugewinngemeinschaft bei Eheleuten nur dem Schutz etwaiger Zugewinnausgleichsansprüche diene, nicht aber dem Schutz von Pflichtteilsberechtigten.
Quelle: Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 13.10.2025 - 3 W 50/25(aus: Ausgabe 01/2026)
- Schenkungen zu Lebzeiten: Rücktrittsklausel im Erbvertrag nimmt Vertragserben den Schutz
Vermächtnisse zu Lebzeiten führen nach dem tatsächlichen Eintritt des Erbfalls immer wieder zu Streitigkeiten, die bis vor die Gerichte führen. In diesem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Nürnberg (OLG) stritten zwei Geschwister über die Bindungswirkung des Erbvertrags ihrer Eltern und darüber, ob der Bruder von seiner Schwester wertvolle Geld- und Grundstücksschenkungen zurückfordern kann, die der Vater ihr zu Lebzeiten gemacht hatte.
Die Eheleute hatten sich 1969 in einem notariellen Erbvertrag gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt und festgelegt, dass ihre beiden Kinder nach dem Tod des Längstlebenden alles erben sollten. Jahrzehnte später, im Jahr 2015, ergänzten sie diesen Erbvertrag notariell und verteilten einzelne Immobilien schon vorab als Vermächtnisse. Sie hielten zusätzlich fest, dass der überlebende Ehegatte später die Erbquoten frei ändern oder sogar einzelne Kinder enterben könne. Außerdem vereinbarten die Eltern ausdrücklich ein unbeschränktes Rücktrittsrecht vom Erbvertrag. Der Vater hatte seiner Tochter über viele Jahre hinweg mehrere Zuwendungen gemacht, unter anderem Geldüberweisungen von insgesamt über 100.000 EUR sowie zwei Schenkungen von Grundstücken, auf denen die Tochter später Häuser baute. Der Bruder sah darin eine Beeinträchtigung seiner vertraglichen Erberwartung. Er klagte deshalb auf Herausgabe der Grundstücke, hilfsweise auf Wertersatz, sowie auf Zahlung weiterer Beträge.
Nachdem das Landgericht dem Bruder teilweise noch Ansprüche zugestanden hatte, hob das OLG dieses Urteil jedoch vollständig auf und wies die Klage ab. Entscheidend war nach Ansicht des Gerichts, dass die spätere Rücktrittsklausel den Erbvertrag so weit abschwächt hatte, dass eine "berechtigte Erberwartung" des Sohns gar nicht mehr entstanden sein kann. Das Gericht argumentierte: Wenn sich die Eltern jederzeit wieder vom Erbvertrag hätten lösen können, konnten sie auch zu Lebzeiten frei verschenken. Die objektive Beeinträchtigung eines verbindlich erwartbaren Erbes, worauf der Sohn seine Klage stützte, sei daher nicht gegeben. Das OLG stellte weiterhin klar, dass ein Rücktrittsrecht auch nachträglich wirksam vereinbart werden kann. Es genügt, dass die Vertragsparteien es in einer ergänzenden notariellen Urkunde festhalten. Ein solches Rücktrittsrecht wirkt zudem auch rückwirkend: Selbst ältere Schenkungen aus der Zeit vor der Ergänzung können nicht mehr angegriffen werden, wenn das Rücktrittsrecht später vereinbart wurde.
Hinweis: Ein Erbvertrag bindet die Beteiligten nur so lange, wie sie sich nicht ausdrücklich vorbehalten, wieder davon abrücken zu dürfen. Wird in einem Erbvertrag - auch nachträglich - ein umfassendes Rücktrittsrecht vereinbart, kann ein Vertragserbe meist nicht mehr erwarten, den Nachlass sicher zu erhalten. Schenkungen zu Lebzeiten lassen sich dann in der Regel nicht mehr mit dem Argument angreifen, sie verletzten eine geschützte Erberwartung.
Quelle: OLG Nürnberg, Urt. v. 24.10.2025 - 1 U 555/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- Auswahl ohne Anhörung: BGH weist Bestimmung eines Berufsbetreuers statt der Mutter als Verhinderungsbetreuerin zurück
Muss ein Mensch unter Betreuung gestellt werden, ist die Auswahl des Betreuers nie leicht. Eines jedoch ist gesetzlich vorgegeben: Gibt es einen Elternteil mit persönlicher Bindung zum Betroffenen und wird dieser Elternteil vom Betroffenen wiederholt als Wunschbetreuer benannt, können nur gewichtige Gründe des Wohls des Betreuten einer Bestellung des Elternteils entgegenstehen. Diese gewichtigen Gründe ordentlich festzustellen, ist laut Bundesgerichtshof (BGH) unabdingbar.
Für die 1999 geborene Betroffene mit einer geistigen Behinderung im Sinne einer leichten Intelligenzminderung war seit 2017 eine Betreuung mit umfassendem Aufgabenkreis eingerichtet. Diese Betreuung wurde verlängert, und als Betreuer wurde der Vater bestellt. Als Verhinderungsbetreuer wurde ein Berufsbetreuer bestimmt, was nicht dem ausdrücklichen Wunsch der Frau entsprach, nur durch ihre Eltern betreut werden zu wollen. Die Mutter hielt das zuständige Landgericht jedoch für nicht geeignet, da gegen eine angemessene Betreuung deren soziale Fähigkeiten und psychische Verfassung sprächen. Daher wehrte sich deren Tochter gerichtlich gegen die Auswahl des Verhinderungsbetreuers.
Der BGH gab der Frau Recht. Die Auswahl war verfahrensfehlerhaft erfolgt. Vermeintlich ungeeignete Angehörige müssten stets die Möglichkeit erhalten, zu gerichtlichen Feststellungen Stellung zu beziehen - und ebendies war hier unterblieben. Grundsätzlich sollte bei der Auswahl dem Wunsch des Betroffenen Rechnung getragen werden - es sei denn, die Wunschperson ist ungeeignet. Erst nach einer entsprechenden Feststellung darf ein Berufsbetreuer statt des Wunschkandidaten aus der Familie benannt werden. Hier gab es dafür lediglich Anhaltspunkte und es sprach laut BGH gegen den Amtsermittlungsgrundsatz, dass das Gericht die Eignung der Mutter in Zweifel zog, ohne sie angehört zu haben.
Hinweis: Das Gericht hätte hier ordentlicher prüfen bzw. begründen müssen, warum es dem Vater einen Berufsbetreuer als Verhinderungsbetreuer statt der Mutter zur Seite gestellt hat. Steht die ehrenamtliche Betreuung durch eine Mutter im Raum, müssen gewichtige Gründe gegen deren Bestellung sprechen.
Quelle: BGH, Beschl. v. 24.09.2025 - XII ZB 513/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- Haushaltszuweisungsverfahren: Wer nach der Trennung Haushaltsgegenstände alleine nutzt, muss Nutzungsentschädigung zahlen
Trennen sich Eheleute, muss auch der Haushalt aufgeteilt werden. Eine Möglichkeit hierzu ist das sogenannte Haushaltszuweisungsverfahren: Nutzen Ehegatten in der Trennungszeit einen Haushaltsgegenstand allein, müssen sie dem anderen dafür eine Gebühr bezahlen. Wie hoch diese ausfällt, bestimmt das Gericht, so wie in diesem Fall der Bundesgerichtshof (BGH).
In einem Haushaltszuweisungsverfahren wurde einem Ehegatten ein Pkw zugewiesen und eine Nutzungsvergütung hierfür festgelegt. Die Eheleute hatten zwei Kinder, bei dem Fahrzeug handelt es sich um das Familienauto. Dieses nahm die Mutter bei der Trennung an sich, einschließlich zweier Kindersitze und eines Fahrradträgers. Der Vater zahlte die Steuern und Versicherungsbeiträge für den Pkw allein und fuhr selbst das Auto seiner Schwester. Später dann nahm er die Kinder zu sich. Die Mutter wurde verpflichtet, das Auto samt Kindersitzen, Schlüsseln und Fahrradträger an den Vater zur alleinigen Nutzung zu übergeben. Dafür sollte der Vater monatlich 150 EUR an Nutzungsentschädigung bezahlen. Außerdem sollte er weiterhin die Versicherung und die Steuern tragen. Gegen die Nutzungsentschädigung ging der Vater gerichtlich vor.
Und er behielt Recht. Laut BGH können Gerichte Haushaltsgegenstände zwar aufteilen und eine angemessene Vergütung für die Benutzung der zugewiesenen Haushaltsgegenstände festsetzen - 150 EUR waren hier jedoch nicht angemessen. Unklar ist, wie man hier überhaupt auf den Betrag gekommen ist. Üblicherweise wird auf die Miete für einen entsprechenden Gegenstand abgestellt und diese dann in Relation zum Einkommen des Nutzers gesetzt. Dies ist hier unterblieben. Hier hat man das Einkommen nicht berücksichtigt.
Hinweis: "Pi mal Daumen" geht auch vor Gericht nicht. Das Gericht muss eine Angemessenheit nachvollziehbar und unter Berücksichtigung aller Umstände des Falls festlegen.
Quelle: BGH, Beschl. v. 24.09.2025 - XII ZB 114/25(aus: Ausgabe 01/2026)
- Unionsrecht: Mitgliedstaaten müssen in Europa geschlossene Ehen gleichgeschlechtlicher Paare anerkennen
Die Europäische Union (EU) besteht derzeit aus 27 Staaten. Viel wird über die EU reguliert. Dennoch unterscheiden sich ihre Mitgliedstaaten oft in grundsätzlichen Einstellungen - zum Beispiel bei der zur Ehe gleichgeschlechtlicher Paare. Eines ist nach dem folgenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nun aber klar: Gehen Unionsbürger in einem EU-Staat rechtmäßig eine Ehe ein, muss jeder Staat im Staatenverbund diese Ehe anerkennen.
Im Jahr 2018 heirateten zwei polnische Staatsangehörige - einer davon mit zusätzlicher deutscher Staatsangehörigkeit - in Berlin. Sie planten den Umzug nach Polen und beantragten die Umschreibung der in Deutschland ausgestellten Eheurkunde im polnischen Personenstandsregister. Dies ist notwendig, damit die Ehe in Polen anerkannt wird. Polen lehnte dies jedoch ab, da es im polnischen Recht keine gleichgeschlechtliche Ehe gibt. Die Eheleute wehrten sich dagegen. Das polnische Gericht entschied nicht sofort, sondern legte den Fall dem EuGH vor. Dieser musste nun darüber entscheiden, ob die polnische Verfahrensweise mit dem sogenannten Unionsrecht vereinbar sei.
Der EuGH entschied salomonisch: Die Regelung "Ehe" falle zwar durchaus in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, bei der jeweiligen Regelung sei das Unionsrecht aber stets zu wahren. Jeder Unionsbürger genieße schließlich Freizügigkeit innerhalb der EU. Diese Freizügigkeit umfasse das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten und sowohl im Zuge der Ausübung dieses Rechts als auch nach der Rückkehr in den eventuellen Herkunftsmitgliedstaat ein normales Familienleben zu führen. Die Verweigerung der Anerkennung einer Ehe zweier Unionsbürger gleichen Geschlechts hebelt dieses Recht aus. Die Eheleute müssten ja dann in ihrem Herkunftsmitgliedstaat wie ledige Personen leben, womit man ihnen die Vorzüge der Ehe wieder nehmen würde. Polen muss also für die Umschreibung der Eheurkunde und die Anerkennung der Ehe sorgen.
Hinweis: Eine Anerkennung der Ehe darf von einem Mitgliedstaat der EU nur verweigert werden, wenn dies die nationale Identität des Staates oder dessen öffentliche Ordnung gefährden würde oder die Ehe rechtswidrig geschlossen worden wäre. Beides war hier nicht der Fall.
Quelle: EuGH, Urt. v. 25.11.2025 - C-713/23(aus: Ausgabe 01/2026)
- Unterhaltsanspruch: Volljährige Kinder müssen Einkünfte offenbaren
Unterhalt erhält, wer bedürftig ist. Ist man nicht mehr bedürftig, muss man das dem Unterhaltsgläubiger auch entsprechend anzeigen. Unterlässt man dies und nimmt stattdessen weiterhin Zahlungen entgegen, dann kann dies sittenwidrig sein. Dass der zahlende Part dabei jedoch nicht immer die Meldung des Unterhaltsempfängers abwarten und im Ernstfall das überzahlte Geld komplett zurückfordern kann, beweist der folgende Fall des Amtsgerichts Frankenthal (AG).
Ein inzwischen volljähriges Kind erhielt aus gerichtlichem Vergleich aus dem Jahr 2014 weiterhin Kindesunterhalt von monatlich 385 EUR von seinem Vater. Dieser zahlte den Betrag auch dann noch weiter, als der Sohn sein Masterstudium der Chemie bereits im Mai 2021 erfolgreich beendet und im Anschluss ein Promotionsstudium sowie eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter aufgenommen hatte. Dabei verdiente er im Monat rund 1.800 EUR netto. Im Januar 2025 sah der Vater in einem Karrierenetzwerk, dass sein Sohn bereits arbeitete, und forderte daraufhin den überzahlten Unterhalt zurück.
Das AG sprach dem Vater gegen seinen Sohn einen Anspruch auf rund 7.400 EUR wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung (§ 826 Bürgerliches Gesetzbuch) für 19 Monate der Überzahlung zu. Der Sohn hätte ungefragt seine veränderten Einkommensverhältnisse ab Juni 2021 anzeigen müssen. Das zu unterlassen, war sittenwidrig. Allerdings wurde der Anspruch auf die Zahlungen bis zum Ablauf des Jahres 2022 begrenzt. Denn danach war die Regelstudienzeit abgelaufen, der Vater hätte von sich aus nach dem Stand des Studiums fragen können. Da er dies nicht getan hatte, hat er nun auch keine weiteren Ansprüche.
Hinweis: Schulden Sie Unterhalt, fragen Sie ab und an nach den Einkommensverhältnissen des Empfängers. So bewahren Sie sich für den Fall der Fälle Ihren Rückzahlungsanspruch. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass man als Empfänger offenbart, wenn man auf Zahlungen des Vaters nicht mehr angewiesen ist.
Quelle: AG Frankenthal (Pfalz), Beschl. v. 17.09.2025 - 71 F 25/25(aus: Ausgabe 01/2026)
- Verfahrenskostenhilfe abgelehnt: Bei schneller Resonanz reicht E-Mail-Postfach für Sorgerechtsausübung aus dem Ausland
Frisch entflammte Liebe kennt keine Entfernung und brennt oft auch über Kontinente hinweg lichterloh. Wenn die Glut aber erloschen ist und Kinder aus der Beziehung entstanden sind, kann die Ferne emotional zwar wohltuend, faktisch aber auch kompliziert sein. Eine Mutter wollte dem entfernt lebenden Vater daher die elterliche Sorge entziehen lassen und beantragte dafür Verfahrenskostenhilfe (VKH). Das Amtsgericht (AG) lehnte ab, das Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) war daraufhin gefragt.
Nachdem sich die Eltern eines dreijährigen Kindes getrennt hatten, zog der Vater - ein Amerikaner - in die USA zurück. Das Kind lebte weiterhin bei seiner Mutter. Diese wollte nun gerichtlich das Ruhen der elterlichen Sorge des Vaters feststellen lassen, da sie etwa Einwilligungen für wichtige behördliche Maßnahmen - wie etwa die Anmeldung zum Kindergarten - nur nach "wochenlangem Erinnern und Bitten" vom Vater erhalten hatte. Sie habe nun Angst, dass dies zur Regel werde und der Vater etwa auch die Zustimmung für den bereits im letzten Sommer gebuchten Urlaub verweigern könne. Er habe sowieso nie viel Interesse am Kind gezeigt. Für das Verfahren beantragte sie nun VKH.
Ihr Antrag wurde vom zuständigen AG jedoch abgewiesen. Denn das Gericht hatte dem Vater den Antrag per Brief und per Mail zugestellt und er reagierte noch am selben Tag per Mail. Auch auf weitere Anfragen des Gerichts reagierte er unverzüglich. Die Mutter legte nach der negativen Entscheidung beim OLG Beschwerde ein, scheiterte aber auch hier. Ein Ausübungshindernis an der elterlichen Sorge bestehe dann, wenn ein Elternteil die gesamte elterliche Sorge oder auch Teilbereiche davon nicht selbst wahrnehmen könne. Dies war hier aber nicht der Fall. Denn der Kindsvater war über die moderne Kommunikationstechnik jederzeit erreichbar und reagierte auch prompt. Dies reiche in Augen des OLG zur Ausübung der elterlichen Sorge aus, die Ablehnung der VKH war bei diesen geringen Aussichten auf Erfolg daher zu Recht erfolgt.
Hinweis: Entfernung allein ist kein Ausübungshindernis. Hinzukommen müssten weitere Umstände - etwa, dass das Elternteil sich tatsächlich nicht kümmert, nicht reagiert, kein E-Mail-Postfach hat. Dies war hier aber nicht gegeben, der Vater hatte sein Interesse durch schnelle Reaktion bekundet.
Quelle: OLG Karlsruhe, Beschl. v. 16.10.2025 - 20 WF 49/25(aus: Ausgabe 01/2026)
- Abmahnung nicht unentbehrlich: AfD-Parteizentrale muss erst gemäß vertraglichem Sonderkündigungsrecht geräumt werden
Zur einer großen Meldung wurde eine Frage, die für das Landgericht Berlin (LG) in Mietrechtsachen quasi zum Tagesgeschäft gehört: Muss der Bundesverband der AfD seine Bundesgeschäftsstelle verlassen, weil der Vermieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses für unzumutbar erklärt hat? Dem Gericht blieb trotz aufgeheizter medialer Begleitung nichts anderes übrig, als - wie immer ganz unaufgeregt - zu prüfen, ob eine vorzeitige Räumung möglich war oder ob die vertraglich vereinbarten Termine galten.
Im Mittelpunkt stand ein Streit zwischen dem Vermieter und der Partei über die Nutzung der angemieteten Räume. Bei einer Wahlfeier im Februar 2025 nutzte die Partei den Innenhof und projizierte ihr Logo auf die Außenfassade des Gebäudes. Der Vermieter meinte jedoch, dass diese Bereiche nicht Teil des Mietvertrags und somit ohne Erlaubnis nicht nutzbar seien. Außerdem sei der Zugang zum Gebäude stundenlang von der Polizei gesperrt worden, so dass andere Mieter das Haus nicht mehr haben betreten können. Der Vermieter wollte deshalb das Mietverhältnis sofort beenden und verlangte eine schnelle Räumung.
Das LG sah zwar, dass die Partei den Vertrag verletzt hatte, weil die Nutzung des Hofs und der Fassade nicht abgedeckt war und vorher eine Zustimmung notwendig gewesen wäre. Dennoch erklärte das Gericht die sofortigen Kündigungen für unwirksam. Bevor eine fristlose Beendigung möglich gewesen wäre, hätte der Vermieter eine Abmahnung aussprechen müssen. Nach Ansicht des LG war dieser Schritt auch nicht ausnahmsweise entbehrlich. In der Verhandlung wurde zudem betont, dass das besondere Schutzrecht politischer Parteien nach Art. 21 Grundgesetz in die Interessenabwägung einfließen musste. Am Ende musste die Partei nur zu den im Vertrag vorgesehenen Terminen - je nach angemieteter Fläche zum 30.09., 30.11. oder 31.12.2026 - ausziehen. Diese Termine beruhten auf einem vertraglichen Sonderkündigungsrecht, das die Partei anerkannte.
Hinweis: Wer außerordentlich kündigen will, muss in der Regel vorher abmahnen. Ohne Abmahnung bleibt eine fristlose Kündigung oft unwirksam. Bei politischen Parteien sind zudem besondere verfassungsrechtliche Vorgaben zu beachten.
Quelle: LG Berlin II, Urt. v. 26.09.2025 - 3 O 151/25(aus: Ausgabe 01/2026)
- Gekrähe und Gesumme: Nachbarn müssen Hühner und Bienen im Stadtgebiet nicht hinnehmen
Der folgende Fall ist vor allem deshalb interessant, weil sich zwei Nachbarn im städtischen Wohnumfeld über Lärmemissionen der etwas anderen Art stritten. Denn hier musste das Landgericht Köln (LG) die Frage beantworten, ob ein Nachbar Hähne und Bienenvölker in einem städtischen Wohngebiet halten durfte, die nebenan als störend empfunden wurden. Wichtig bei der Bewertung war, ob ein prägender dörflich-ländlicher Charakter vorherrschte oder eben nicht.
Im Mittelpunkt stand ein Streit zwischen benachbarten Hauseigentümern in Köln. Auf einem der Grundstücke lebten seit 2021 Hähne und Hühner sowie seit einigen Jahren mehrere Bienenstöcke mit teils mehreren Tausend Bienen. Die Nachbarn fühlten sich durch das Krähen des Federviehs ebenso gestört wie durch die Bienen, da sich die Tiere nicht um Grundstückgrenzen scherten, sich im Garten aufhielten und sogar im Pool landeten. Das Amtsgericht ordnete daher an, dass sowohl Hähne als auch Bienenvölker zu entfernen seien und keine neuen Tiere gehalten werden durften. Die weitergehenden Forderungen der Nachbarn, etwa zur Beseitigung von Mist oder bestimmten Bäumen, hatten keinen Erfolg.
Gegen diese Entscheidung legte der Tierhalter Berufung ein, doch das LG bestätigte das Urteil vollständig. Nach Auffassung des Gerichts dürfe der durchschnittliche Bewohner eines Stadtgebiets erwarten, dass sein Grundstück ein Ort der "Ruhe" bleibt. Hahnenrufe würden hingegen spontan und zu verschiedenen Zeiten auftreten und können daher als besonders störend wahrgenommen werden. Auch die große Anzahl an Bienen, ihre Nähe zum Nachbargrundstück und die sichtbaren Spuren im Garten führten zu einer unzumutbaren Belastung. Das LG stellte klar, dass diese Einwirkungen nicht mehr als geringfügig einzustufen waren. Eine Pflicht, die Tierhaltung als "ortsüblich" zu akzeptieren, bestand nicht, da der Tierhalter nicht nachweisen konnte, dass eine solche Nutzung im städtischen Umfeld üblich war. Damit durfte die Nachbarschaft verlangen, dass die Tiere entfernt werden.
Hinweis: Ob eine Störung erheblich ist, bestimmt sich nach dem Empfinden einer durchschnittlichen Person. Tierhaltung im Wohngebiet muss sich an der Umgebung orientieren. Wer Tiere hält, muss sicherstellen, dass Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.
Quelle: LG Köln, Urt. v. 21.05.2025 - 13 S 202/23(aus: Ausgabe 01/2026)
- Mieterhöhung abgelehnt: Gute Erreichbarkeit von ÖPNV und Geschäften bereits im Mietspiegel berücksichtigt
Urbanes Leben erscheint als besonders attraktiv, wenn es eine gute Verkehrsanbindung aufweist. Für Vermieter eine heikle Angelegenheit, denn eine gute Anbindung heißt oft auch Lärm, und den haben Mieter bekanntlich nicht so gern. Ob eine Mieterhöhung dennoch gerechtfertigt ist, wenn Mieter starkem Verkehrslärm ausgesetzt sind, musste das Amtsgericht Berlin-Mitte (AG) auch unter dem Gesichtspunkt bewerten, ob kurze Wege zu Bus, Bahn und Einkaufsmöglichkeiten den Wohnwert erhöhen.
In dem Fall ging es um eine Berliner Wohnung aus dem Jahr 1900, die rund 55 qm groß war. Ein Zimmer lag direkt zur sechsspurigen Straße hin, an der auch eine Straßenbahn im Tag- und Nachtbetrieb fuhr. Messungen zeigten einen hohen Geräuschpegel an der Fassade. Die Vermieterin verlangte Ende 2024 eine höhere Miete und verwies zur Begründung auf den Mietspiegel 2024. Die Mieterin lehnte die Erhöhung jedoch ab. Vor Gericht trug die Vermieterin vor, dass die gute Erreichbarkeit von Verkehrsmitteln und Geschäften den Wohnwert steigern müsse. Außerdem meinte sie, der Straßenlärm sei nicht relevant, da schließlich nur ein Zimmer zur Straße zeigte.
Das AG folgte der Argumentation der Vermieterin jedoch nicht. Nach seiner Ansicht überschritt die Wohnung schon ohne Erhöhung die ortsübliche Vergleichsmiete. Zusätzlich bestätigte das Gericht, dass die Verkehrssituation den Wohnwert deutlich minderte. Der Lärm sei für eine typische Nutzung der Wohnung stark störend, weil er Schlaf, Arbeit und Erholung beeinträchtigte. Dass nur eines der Zimmer betroffen war, spielte dabei keine Rolle, da bereits ein stark belasteter Raum die Wohnqualität herabsetze. Auch die Nähe zum öffentlichen Nahverkehr und zu den Supermärkten wertete das Gericht nicht als Vorteil. Diese Merkmale seien im Mietspiegel schließlich bereits bei der Einstufung der Lage berücksichtigt worden. Eine weitere Berücksichtigung sei daher unzulässig. Die Vermieterin konnte die verlangte Mieterhöhung somit nicht durchsetzen.
Hinweis: Verkehrslärm kann den Wohnwert deutlich mindern. Nähe zu Bus, Bahn oder Einkaufsmöglichkeiten führt nicht immer zu einer höheren zulässigen Miete. Entscheidend bleibt, was der Mietspiegel vorgibt.
Quelle: AG Berlin-Mitte, Urt. v. 11.09.2025 - 6 C 5023/25(aus: Ausgabe 01/2026)
- Räumungsklage abgewiesen: Geschäftliche Nutzung einer Wohnung ohne offensichtlichen Geschäftsbetrieb erlaubt
Erst eine Untervermietung und dann noch Geschäftstätigkeiten in der Mietwohnung? Das war einer Vermieterin zu viel und so kündigte sie ihrem Mieter nach fast 30 Jahren das Mietverhältnis, weil sie unter anderem die Grenze zum Zweck des "Wohnens" für überschritten hielt. Ob zu Recht oder nicht, das musste das Amtsgericht München (AG) klären und nahm sich dazu eine bereits erfolgte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Hand.
Der Mieter hatte einen Untermieter aufgenommen und zudem seine Wohnadresse als Geschäftsadresse verwendet. Die Vermieterin meinte, in der Wohnung sei ein Laden für Sportgeräte betrieben worden, und kündigte mehrfach fristlos. Sie behauptete, über die Wohnung seien Waren gelagert, angeliefert und versendet worden. Beweise dafür gab es jedoch keine. Nach den Feststellungen des Gerichts trat der Bewohner mit seiner Tätigkeit nicht nach außen auf, empfing keine Kundschaft und beschäftigte keine Mitarbeiter in der Wohnung. Nach der Rechtsprechung des BGH gilt die Nutzung der Räumlichkeiten bei einer derartigen Tätigkeit, die nur im häuslichen Umfeld stattfand, weiterhin als Wohnen.
Das AG stellte daher ebenso klar, dass allein die Nutzung der Wohnanschrift als Geschäftsadresse keine Zweckentfremdung darstellte. Auch die Kündigung wegen des Untermieters führte nicht zum Erfolg. Zwar hätte der Bewohner die Untervermietung melden müssen, doch lag sein berechtigtes Interesse auf der Hand. Das Mietverhältnis bestand seit fast 30 Jahren, und die Vermieterin hätte die Untervermietung ohnehin genehmigen müssen. Damit blieben sowohl die fristlosen als auch die ordentlichen Kündigungen unwirksam. Das AG wies die Räumungsklage ab und verpflichtete die Vermieterin, die Untervermietung zu erlauben.
Hinweis: Die geschäftliche Nutzung einer Wohnung wird nur dann problematisch, wenn sie nach außen hin sichtbar ist. Die reine Adressnennung genügt nicht für eine Kündigung. Auch bei einer Untervermietung entscheidet oft das berechtigte Interesse.
Quelle: AG München, Urt. v. 18.09.2025 - 419 C 23314/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- Weiterführung unzumutbar: Fristlose Kündigung nach rassistischer und menschenverachtender Beleidigung des Vermieters
Auch wenn sich die Grenzen des Sagbaren immer stärker zu verschieben drohen: Gerichte wie das Amtsgericht Hannover (AG) kennen nach wie vor keine Nachsicht bei menschenverachtenden Beleidigungen. So musste das Gericht prüfen, ob ein Aufrechterhalten des Mietverhältnisses auch dann zumutbar sein kann, nachdem der Vermieter von seiner Mieterin rassistisch herabgesetzt wurde.
Ein Vermieter hatte 2023 ein Wohngebäude gekauft, in dem die Beklagte als Mieterin wohnte. Nach einem Vorfall am 22.12.2024 kündigte der Vermieter das Mietverhältnis außerordentlich fristlos und hilfsweise ordentlich. Der Vermieter gab an, die Mieterin habe ihn an seiner Wohnanschrift mit rassistischen und menschenverachtenden Äußerungen beleidigt, darunter Ausdrücke wie "Ihr Kanacken" und "Bald kommt die AfD. Euer Leben wird genauso enden wie bei den Juden!" sowie "Scheiß Ausländer". Dadurch sei das Vertrauensverhältnis massiv verletzt worden. Die Mieterin bestritt die Vorwürfe und behauptete, sie sei an diesem Tag gar nicht zu Hause gewesen. Sie meinte, der Vermieter habe sie vorher bereits eingeschüchtert und unter Druck gesetzt.
Das AG stellte hingegen fest, dass der Vermieter durchaus glaubhaft darlegen konnte, dass das Treffen stattgefunden hatte und die beleidigenden Aussagen tatsächlich gefallen sind, denn Zeugenaussagen bestätigten den Ablauf und die Wortwahl der Mieterin. Nach Einschätzung des Gerichts handelte es sich damit um schwerwiegende Pflichtverletzungen, die eine Weiterführung des Mietverhältnisses unzumutbar machten. Selbst der behauptete unangekündigte Besuch des Vermieters war nach Ansicht des Gerichts zulässig, da Vermieter berechtigt sind, bei ihrem Mieter zu klingeln. Die fristlose Kündigung beendete das Mietverhältnis daher rechtswirksam; der Vermieter hatte Anspruch auf die Herausgabe der geräumten Wohnung.
Hinweis: Rassistische und menschenverachtende Äußerungen gegenüber Vermietern oder Nachbarn können eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Zeugenangaben sind hierbei besonders wichtig, um das Verhalten zu belegen. Auch unangekündigte Besuche des Vermieters können zulässig sein, wenn sie der Wahrung seiner Rechte dienen.
Quelle: AG Hannover, Urt. v. 10.09.2025 - 465 C 781/25(aus: Ausgabe 01/2026)
- Angabe fiktiver Personalien: Wer nicht sachdienlich an der Fahrerermittlung mitwirkt, muss Fahrtenbuchauflage hinnehmen
Nach Geschwindigkeitsverstößen meint man allgemeinhin, dass ein Foto aussagekräftig genug sei, um den "Bleifuß" zu ermitteln. Doch immer wieder ist es an den Gerichten, zu bewerten, ob die behördlichen Ermittlungsversuche ausreichend waren und deren Anordnungen vor Justitia Bestand haben. So kam der Fahrzeughalter hier vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (VG) zwar um Fahrverbot und Bußgeld herum, ohne Folgen blieb sein nicht sachdienliches Mitwirken aber nicht.
Mit dem auf den Fahrzeughalter zugelassenen Pkw wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts um 39 km/h überschritten. Dieser Verkehrsverstoß hätte demnach ein Bußgeld von 260 EUR, ein Fahrverbot für einen Monat und zwei Punkte "in Flensburg" zur Folge gehabt. Im Ordnungswidrigkeitenverfahren gab der Mann als Fahrerin den Namen einer Frau, ein Geburtsdatum und eine Adresse in Essen an. Da diese Person in Essen jedoch nicht ermittelt werden konnte, wurde ein Anhörungsbogen an die angegebene Anschrift versandt. Daraufhin wurde der Verstoß im Wege der Onlineanhörung auch zugegeben. Nachdem die angegebene Fahrerin jedoch weiterhin nicht ermittelt werden konnte, vermerkte die zuständige Sachbearbeiterin in der Ermittlungsakte, die angegebene Anschrift sei eine "Fakeanschrift". Es bestand der Verdacht, dass Name und Adresse von dem Fahrzeughalter als Tarnadresse für falsche Identitäten zur Verfügung gestellt wurden. Nach Auskunft des Vermieters sei der Mann zwar unter der Anschrift gemeldet, wohne aber nicht in der Wohnung, deren Miete das Jobcenter zahle. Er wohne mit seiner Familie an einer anderen Anschrift. Da ein Abgleich des Fotos der Verkehrsüberwachung mit dem Passfoto der Ehefrau des Klägers keine eindeutige Fahrerfeststellung ermöglichte und diese in einer weiteren Anhörung abstritt, Fahrerin gewesen zu sein, wurde das Ordnungswidrigkeitenverfahren eingestellt. Die Stadt Essen ordnete daraufhin die Führung eines Fahrtenbuchs an, um künftige Verkehrsverstöße mit dem auf den Mann zugelassenen Fahrzeug aufklären zu können. Er wehrte sich im Zuge einer Klage gegen diese Anordnung.
Die Klage gegen die Anordnung, für die Dauer von 18 Monaten ein Fahrtenbuch zu führen, hatte vor dem VG keinen Erfolg. Weder der Kläger noch sein Rechtsanwalt waren zur mündlichen Verhandlung erschienen. Bezeichnend sei, dass sämtliche Feststellungen der beklagten Stadt auch nach Akteneinsicht durch den Rechtsanwalt im Rahmen des Klageverfahrens nicht bestritten oder wenigstens angezweifelt worden seien. Durch die Angabe falscher Personalien habe der Kläger zwar formal mitgewirkt, sich jedoch nicht sachdienlich geäußert. Vielmehr habe er versucht, durch die Falschangaben die wahre Fahrerin zu schützen. Angesichts dessen erübrigten sich weitere Ermittlungsversuche der Ordnungswidrigkeitenbehörde.
Hinweis: Wer zur Aufklärung eines Verkehrsverstoßes eine bloße "Briefkastenadresse" und fiktive Personalien angibt, wirkt nicht ausreichend an der Ermittlung des Fahrers mit. Weitere Ermittlungsversuche der Ordnungswidrigkeitenbehörde erübrigen sich dann.
Quelle: VG Gelsenkirchen, Urt. v. 23.09.2025 - 14 K 2411/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- Ausfahrt aus Grundstück: Wer mit dem fließenden Straßenverkehr kollidiert, haftet in den meisten Fällen
Nach einer Kollision eines aus einer Ausfahrt herauskommenden Fahrzeugs mit einem Motorrad im fließenden Verkehr berief sich der in Anspruch genommene Versicherer auf die gegnerische Verletzung der Vorschrift zur Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge (§ 7 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)), um den Anspruch auf vollen Schadensersatz zu mindern. Doch das Brandenburgische Oberlandesgericht (OLG) schaute sich die Sachlage genauer an.
Ein Autofahrer wollte aus seiner Grundstücksausfahrt, die sich in einer verkehrsberuhigten Straße mit Parkmöglichkeiten am Fahrbahnrand befand, in den Fließverkehr einfahren. Von links näherten sich ein langsam fahrender Pkw sowie ein Kraftradfahrer. Nachdem der Motorradfahrer den vor ihm fahrenden Pkw überholte, ohne dabei die zulässige Geschwindigkeit zu überschreiten, kollidierte er mit dem mit ca. 11 km/h aus dem Grundstück ausfahrenden Auto. Der Kraftradfahrer forderte daraufhin vollen Schadensersatz. Doch weil die Versicherung nur teilweise zahlte, ging die Sache vor Gericht.
Das OLG entschied, dass den Autofahrer, der aus dem Grundstück ausfuhr, die alleinige Schuld an dem Unfall treffe. Der Kraftradfahrer hat nicht gegen das Verbot des Fahrstreifenwechsels gemäß § 7 StVO verstoßen, da hierdurch nur die anderen Fahrzeuge im Fließverkehr geschützt werden sollen. Der aus der Ausfahrt Fahrende ist davon nicht umfasst. Auch ein Überholen bei unklarer Verkehrslage war seitens des Motorradfahrers nicht gegeben, da die Ausfahrt nicht erkennbar war. Wer mit 11 km/h aus einer Grundstücksausfahrt in den Fließverkehr einfahre, obwohl die Sicht durch parkende Fahrzeuge eingeschränkt ist, verhalte sich so verkehrswidrig, dass auch die einfache Betriebsgefahr des Kraftrads dahinter zurückstehe.
Hinweis: Derjenige, der von einem anderen Straßenteil - beispielsweise aus einer Parkbucht oder Grundstückseinfahrt - auf die Fahrbahn einfährt, hat sich so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Die auf der Straße fahrenden Fahrzeuge haben gegenüber dem vom rechten Fahrbahnrand anfahrenden und in die Straße einfahrenden Verkehr Vorrang - und auf diesen Vorrang gegenüber dem einfahrenden Verkehr dürfen die auf der Straße fahrenden Fahrzeuge vertrauen.
Quelle: Brandenburgisches OLG, Urt. v. 11.09.2025 - 12 U 96/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- Kfz-Halterhaftung bestätigt: Kollision von abhebendem Fasan und Schutzhelm ist versicherungstechnisch ein "normaler" Wildunfall
Die Skurrilität dieses Falls zeigt hervorragend auf, dass ein geltendes Regelwerk auch auf obskure Lebenssituationen herunterzubrechen ist. Da jedoch auch ein Gericht mit Menschen aus Fleisch und Blut besetzt ist, fiel es der Erstinstanz auch nicht leicht zu beantworten, wer haftet, wenn ein Sozius ohne Schutzkleidung, aber mit Helm an eben jenem von einem just abgehobenen Fasan getroffen und vom Bock des fahrenden Motorrads gekickt wird. Das Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) musste sich daher des Ganzen annehmen, um mit nötigem Ernst erneut Recht zu sprechen.
Der spätere Kläger war Ende April 2023 als Sozius auf dem Motorrad des Versicherungsnehmers der beklagten Haftpflichtversicherung unterwegs. Nach einer langgezogenen Linkskurve beschleunigte der Motorradfahrer auf geschätzte 130 bis 140 km/h. Prompt erhob sich ein Fasan aus dem rechten Seitenstreifen und überquerte fliegend die Landstraße - leider nicht so präzise, wie es die Situation erfordert hätte. So prallte der Fasan gegen den Helm des Klägers, wodurch dieser den Halt verlor und von dem Motorrad auf die Straße stürzte. Hierbei verletzte sich der Kläger, der keine Schutzkleidung trug, erheblich. Vor dem Landgericht Osnabrück (LG) nahm der Kläger in der Folge die Haftpflichtversicherung des Fahrers auf Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 25.000 EUR in Anspruch. Das LG lehnte eine Haftung der Beklagten allerdings ab.
Das OLG hat den Fall auf die Berufung des Klägers hin jedoch anders als die Vorinstanz bewertet. Denn der vom Kläger erlittene Schaden sei schließlich "bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs" entstanden. Der Kläger habe sich ausschließlich wegen eben jenes "in Betrieb befindlichen" Motorrads überhaupt vorwärtsbewegt, so dass es auch nur deswegen zum Zusammenstoß habe kommen können. Aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit des Motorrads von mutmaßlich mehr als 100 km/h hätten bei dem Zusammenstoß ganz erhebliche Kräfte gewirkt, die für den Unfall und die Verletzungen des Klägers ursächlich geworden seien. Dies zeige sich "anschaulich" daran, dass es den Fasan richtig schlimm getroffen hatte: Er war durch den Aufprall in drei Teile gerissen worden. Es komme daher nicht darauf an, dass das Motorrad selbst von dem Aufprall nicht betroffen wurde. Und da auch höhere Gewalt nicht vorliege - wie bei einem "normalen" Wildunfall -, musste die Versicherung 17.000 EUR an den Kläger zahlen.
Hinweis: Nach Ansicht des Senats handelte es sich um einen "normalen" Unfall mit einem Wildtier. Fahrer, Beifahrer und das Motorrad als Fortbewegungsmittel bilden eine Einheit, die sich gemeinsam auf der Straße bewegt. Auch wenn hier die Besonderheit besteht, dass nur der Sozius getroffen wurde und sich Motorrad und Fahrer unbeeinträchtigt weiterbewegt haben, handelt es sich doch um eine Kollision zwischen den sich mit der versicherten Motorkraft Bewegenden und einem Wildtier. Es macht für den Sozius auch keinen Unterschied, dass er allein umgeworfen wird statt die gesamte Einheit, und er dadurch (auch) zu Fall kommt. Ein Mitverschulden an den Verletzungen wurde trotz fehlender Schutzkleidung nicht angenommen.
Quelle: OLG Oldenburg, Urt. v. 24.09.2025 - 5 U 30/25(aus: Ausgabe 01/2026)
- Mobiler Blitzer: Fehlende Protokollierung ist als schwerer Fehler im Bußgeldbescheid nicht heilbar
Dieser Fall, der vor dem Amtsgericht Leonberg (AG) landete, beweist, wie wichtig exakte Vorgaben sind - und vor allem auch, wie wichtig Fachleute sind, die erkennen, wann eben jene Vorgaben nicht akribisch eingehalten wurden. Knackpunkt war hier ein sogenannter Enforcementtrailer, der als mobiler Blitzeranhänger jene Fotos schießt, die zahlreiche Autofahrer teuer zu stehen kommen. Dass bei einer derart autonom laufenden Technik exakte, regelmäßige Kontrollen und Protokollierungen nötig sind, versteht sich von selbst. Oder etwa nicht? Lesen Sie selbst.
Bei einem Autofahrer wurde ein Geschwindigkeitsverstoß durch einen Enforcementtrailer ermittelt. Es erging folglich ein Bußgeldbescheid, gegen den der Betroffene Einspruch einlegen ließ. Im Zuge dessen erhielt sein Anwalt Akteneinsicht - und so konnte schließlich festgestellt werden, dass das besagte Messgerät in einem Zeitraum von 14 Tagen ununterbrochen im Einsatz war. Ebenso konnte der Akte entnommen werden, dass die Daten des Geräts zwischen Messbeginn und Messende ausgelesen wurden. Dieser Vorgang wurde mit dem Datum 15.05.2025 durch Unterschrift des für die Messung Verantwortlichen und dem für die Auswertung Verantwortlichen im Protokoll dokumentiert. Der Betroffene war jedoch "erst" am 16.05.2025 erfasst worden. So begründete der Verteidiger seinen Einspruch auch mit berechtigten Zweifeln an der Richtigkeit der Messung, da für die konkrete Messung seines Mandanten am 16.05.2025 maßgebliche Aktenbestandteile wie das Messprotokoll fehlten. Und ohne seien konkrete Feststellungen zum Tatort und Tattag nicht zu treffen. Dennoch nahm die Behörde den Bescheid nicht zurück.
Das AG sah das anders als die Behörde: Nach den Mitteilungen der Behörde fehlten für den Tatzeitpunkt maßgebliche Aktenbestandteile - insbesondere ein Messprotokoll, das sich dem 16.05.2025 zuordnen ließ. Daher seien der Tattag und auch der Tatvorwurf nicht nachprüfbar. Dabei sei vor allem die Tat nicht ausreichend konkretisierbar, was einen wesentlichen Fehler im Bußgeldbescheid bedeute. Das Verfahren wurde eingestellt, der Betroffene musste auch die notwendigen Auslagen seines Verteidigers nicht tragen.
Hinweis: Der Beschluss des AG gibt Anlass, bei Geschwindigkeitsmessungen die Messprotokolle genau zu prüfen und mit den Erfassungsdaten des Mandanten abzugleichen. Bei fehlender Protokollierung liegt ein schwerer Fehler im Bußgeldbescheid vor, der nicht geheilt werden kann.
Quelle: AG Leonberg, Urt. v. 02.10.2025 - 4 OWi 354 Js 89886/25(aus: Ausgabe 01/2026)
- Schutzgut der öffentlichen Sicherheit: Feld- und Waldwegesatzung untersagt E-Scooter-Touren im Weinberg
Was der eine darf, darf der andere noch lange nicht? Gegen eine solche augenscheinliche Ungleichbehandlung wollte in diesem Fall ein Eventunternehmer angehen. Doch das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße (VG) hatte gute Argumente, die gegen diese vermutete Ungleichbehandlung sprachen - beispielsweise, dass motorisierte Rollstühle, sogenannte Krankenfahrstühle, nicht mit E-Scootern zu vergleichen seien, selbst wenn beide Fahrzeuge dieselbe Höchstgeschwindigkeit erreichen.
Der Unternehmer hatte ein Gewerbe zur Durchführung von Lamatouren durch die örtlichen Weinberge angemeldet. Diese Tätigkeit wollte er nun auf E-Scooter-Touren in eben diesen Gebieten erweitern. Die Genehmigung wurde jedoch nicht erteilt, weil in dem Gebiet Verkehrsschilder angebracht sind, die das Nutzen mit Fahrzeugen aller Art untersagen. Und da das angebrachte Zusatzzeichen "Landwirtschaftlicher Verkehr frei" nicht für E-Scooter-Touren gelte, sei eine Genehmigung somit auch nicht möglich. Dennoch bot der Unternehmer Fahrten auch ohne die entsprechende Genehmigung an, und die Behörde bekam erwartungsgemäß Wind davon. Sie erließ daraufhin eine Untersagungsverfügung mit Anordnung der sofortigen Vollziehung und Androhung eines Zwangsgeldes. Dagegen legte der Betroffene Einspruch ein und begründete dies damit, dass die E-Scooter wie Krankenfahrstühle dort nicht schneller als 6 km/h fahren.
Das VG wies den Einspruch dennoch zurück. Zu den Schutzgütern der öffentlichen Sicherheit gehöre es, den Bestand und die Funktionsfähigkeit staatlicher Einrichtungen zu schützen - und auch gemeindeeigene Feld- und Waldwege stellen solche öffentliche Einrichtungen dar. Das Befahren mit dem E-Scooter verstoße gegen das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge aller Art, das durch das Aufstellen der Verkehrsschilder ausgesprochen worden ist. Krankenfahrstühle dürften hingegen grundsätzlich dort fahren, wo Fußgängerverkehr erlaubt ist - und zwar auch in solchen Bereichen, in denen Verkehrszeichen Fahrzeuge aller Art verbieten. Die Durchführung gewerblicher Eventtouren mit E-Scootern auf gemeindlichen Feld- und Waldwegen stellt daher keine von dem in der Feld- und Waldwegesatzung definierten Benutzungszweck (Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Flächen sowie als Fußweg) gedeckte Nutzung dar.
Hinweis: Die Durchführung gewerblicher Eventtouren mit E-Scootern auf gemeindlichen Feld- und Waldwegen stellt keine von dem in der Feld- und Waldwegesatzung definierten Benutzungszweck - Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Flächen sowie als Fußweg - gedeckte Nutzung dar und kann daher untersagt werden.
Quelle: VG Neustadt an der Weinstraße, Beschl. v. 08.09.2025 - 5 L 971/25.NW(aus: Ausgabe 01/2026)
- Direktanspruch gegen Mittelsmann: Betrugsopfer haften trotz grober Fahrlässigkeit nach Geldüberweisung nicht immer mit
In Zeiten vermehrter und vor allem immer ausgeklügelterer Online- und Telefonbetrügereien ist guter Rat teuer, wenn das eigene Geld auf einem fremden Konto gelandet ist. Wenn die eigene Bank daraufhin die Rückerstattung verweigert, weil man ja selbst grob fahrlässig gehandelt hat, kann man den Betrag laut Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) künftig direkt beim Empfänger geltend machen.
Eine Frau hatte am 11.01.2023 einem Betrüger, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab, mehrere Überweisungen über 9.500 EUR auf ein fremdes Konto per PhotoTAN-App genehmigt. Das Geld landete auf dem Konto eines Mannes, der sich selbst als Empfänger bezeichnete und offensichtlich als Mittelsmann erst 5.000 EUR bei einem Bankautomaten und schließlich an den Kassen von rund 20 bis 30 Supermärkten kleinere Beträge abholte, um den Gesamtbetrag schließlich einem anderen zu übergeben. Als der Rückforderungsantrag des Opfers bei der Bank erfolglos blieb, mussten die Gerichte heran.
Das OLG verurteilte nun den Empfänger des Betrags zur entsprechenden Rückzahlung an das Opfer. Es stellte fest, dass der Empfänger sich der leichtfertigen Geldwäsche schuldig gemacht hatte - das Geld stammte schließlich aus einer Straftat, nämlich einem Betrug. Auch wenn die Haupttäter nicht bekannt waren, reichte die rechtswidrige Herkunft des Geldes aus. Der Empfänger hatte die Mittel auf seinem Konto verbraucht oder weitergegeben und sich bewusst der Tatsache verschlossen, dass das Geld aus einer Straftat stammte. Nach den Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 823 Abs. 2) und des Strafgesetzbuchs (§ 261) musste er den Schaden ersetzen. Selbst wenn die Frau grob fahrlässig gehandelt hatte, durfte ihr als Opfer hierbei kein Mitverschulden zugerechnet werden. Es bestand keine Pflicht für sie, die Rechtswidrigkeit der Zahlung zu erkennen.
Hinweis: Wer Opfer einer Geldwäsche wird, kann den Schaden direkt vom Empfänger zurückfordern. Selbst grobe Fahrlässigkeit des Opfers spielt keine Rolle. Banken können zwar beteiligt sein, die Haftung des Täters bleibt aber bestehen.
Quelle: OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 17.10.2025 - 29 U 100/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- Eigene Fehlplanung: Kein Schutz durch Reiserücktrittsversicherung bei verpasstem Flug wegen Stau
Wann genau ist ein Ereignis eigentlich unvorhersehbar und sind die daraus resultierenden Konsequenzen unvermeidbar? Ein Stau auf einer Autobahn stellt jedenfalls kein solches Ereignis dar, wenn man sich die folgenden Begründungen von Landgericht (LG) und Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) anschaut, mit denen eine Frau auf ihren Reisekosten sitzenblieb, ohne dass die eigens abgeschlossene Reiserücktrittsversicherung griff.
Die betreffende Frau buchte einen Flug nach Hawaii ab Hamburg und schloss gleichzeitig eine Reiserücktrittsversicherung ab, die ihr die Reise- und Unterkunftskosten von bis zu 6.500 EUR pro Person ersetzen sollte, wenn die Reise aus bestimmten Gründen unvermeidbar verschoben werden musste. Am Reisetag fuhr sie um 4:00 Uhr morgens in Kiel mit einem Mietwagen los. Auf der Strecke kam es zu einem Unfall und einer Vollsperrung, die über zwei Stunden dauerte. Die Reisende erreichte den Flughafen daher erst um 6:30 Uhr und verpasste den für 6:45 Uhr geplanten Abflug. Sie forderte von der Versicherung nun die Erstattung der entstandenen Mehrkosten von rund 9.000 EUR.
Das LG wies die Klage ab und das OLG bestätigte in einem Hinweisbeschluss, dass die dagegen gerichtete Berufung unbegründet sei. Daraufhin zog die Klägerin ihre Berufung zurück. Das OLG erklärte, dass die verspätete Anreise nicht "unvermeidbar" im Sinne des Versicherungsvertrags war. Unvermeidbar sind nur Ereignisse, deren Folgen auch bei allen zumutbaren Vorkehrungen nicht hätten vermieden werden können. Hier hätte die Reisende genügend Zeitpuffer einplanen müssen, um Verzögerungen durch Kontrollen oder Verkehrsprobleme auszugleichen. Selbst zwei Stunden vor Abflug loszufahren war hier nachweislich nicht ausreichend, da ein schwerer Unfall mit Stau grundsätzlich immer möglich ist. Hätte sie ein angemessenes Sicherheitspolster berücksichtigt, etwa 15 Minuten zusätzlich, hätte sie den Flug trotz des Staus noch erreichen können. Der Versicherungsschutz greift daher nicht, wenn der selbst eingeplante Zeitpuffer zu knapp bemessen ist.
Hinweis: Bei Flugreisen muss immer genügend Zeit für Anreise, Verkehrsrisiken und Sicherheitskontrollen eingeplant werden. Reiserücktrittsversicherungen zahlen nur, wenn Verzögerungen nicht vermeidbar waren. Ein zu knappes Zeitpolster gilt hingegen als eigenes Verschulden.
Quelle: OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 09.09.2025 - 3 U 81/24(aus: Ausgabe 01/2026)
- Haftungsbeschränkung unwirksam: Betreiberin haftet für beschädigte Yacht im "Winterlagerplatz"
Für die Beurteilung, ob ein Vertrag über die Unterstellung einer Yacht als Lagervertrag und nicht als einfacher Mietvertrag zu sehen ist, war entscheidend, welche Pflichten daraus folgen. Denn für die entstandenen Sturmschäden wollte die Vertragspartnerin nicht haften, obwohl beide Seiten einen "Mietvertrag" abgeschlossen hatten. Das Landgericht Hamburg (LG) musste daher entscheiden, in welchem Umfang in Sachen Haftung dieser Vertrag nun galt.
Ein Yachtbesitzer hatte seine Segelyacht auf einem Außengelände der Betreiberin untergebracht und dafür einen Vertrag über einen "Winterlagerplatz" geschlossen. Hallenplätze standen zwar auch zur Verfügung, waren aber teurer. Zudem hätte für eine dortige Unterbringung der Mast umgelegt werden müssen. Am 18.02.2022 zog das Sturmtief Zeynap auf. Ein Mitarbeiter der Betreiberin kontrollierte die Yachten, unternahm aber keine weiteren Sicherungsmaßnahmen. In der Nacht drehte sich die Segelyacht des Eigentümers durch den Wind, der Lagerbock brach und die Yacht stürzte um. Dabei wurden drei weitere Yachten beschädigt. Die Versicherung des Yachtbesitzers forderte von der Betreiberin Schadensersatz in Höhe von über 52.000 EUR. Die Betreiberin argumentierte jedoch, dass es sich um höhere Gewalt gehandelt habe und den Yachtbesitzer wegen des stehenden Masts ein Mitverschulden treffe.
Das LG entschied hingegen, dass der Vertrag durchaus als Lagervertrag zu behandeln war und die Betreiberin daher nicht nur die Bereitstellung des Stellplatzes, sondern auch die ordnungsgemäße Aufbewahrung der eingelagerten Yacht schuldete. Die Betreiberin hatte Hausrecht und Weisungsrechte, führte Kontrollgänge durch und übernahm die Obhutspflichten. Sie hätte bei ungewöhnlicher Windrichtung zusätzliche Sicherungsmaßnahmen veranlassen müssen. Ihre Haftungsbeschränkung im Vertrag war daher unwirksam - sie musste für den entstandenen Schaden aufkommen.
Hinweis: Ein Lagervertrag unterscheidet sich vom Mietvertrag insofern, dass der Betreiber auch für die Sicherheit der eingelagerten Gegenstände verantwortlich ist. Schäden durch Unterlassen von Schutzmaßnahmen können ersetzt werden. Wer Obhutspflichten übernimmt, muss diese ernst nehmen, auch bei ungewöhnlichen Naturereignissen.
Quelle: LG Hamburg, Urt. v. 08.08.2025 - 417 HKO 47/23(aus: Ausgabe 01/2026)
- Kostenerstattung durch Airline: Ursprünglich vereinbarter Zielort ist zentraler Bestandteil des Flugvertrags
"Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien" - so locker wie im vielzitierten angeblichen Fußballerzitat nehmen Reisende ihren "Landeplatz" wohl eher selten. Wo der Flieger landen soll, ist schließlich ein elementarer Bestandteil einer Flugreise. Doch was passiert eigentlich, wenn die Fluggesellschaft nach Buchung den Zielort ändert? Ob man als Fluggast dann den anfallenden Zusatzaufwand ersetzt bekommen kann, klärte das Amtsgericht Düsseldorf (AG).
Ein Fluggast hatte einen Flug von Antalya nach Düsseldorf gebucht, der am 20.08.2024 um 18:20 Uhr landen sollte. Die Airline teilte jedoch ihren Passagieren eine Woche vorher mit, dass der Flug nicht wie geplant durchgeführt werden könne. Statt in Düsseldorf lande das Flugzeug erst in Hannover, und zwar um 0:45 Uhr am nächsten Tag. Der Fluggast musste für die Weiterfahrt nach Düsseldorf daher 81,98 EUR für die Bahn- und 35 EUR für eine Taxifahrt ausgeben. Auf anwaltliche Aufforderung zahlte die Airline diese Kosten jedoch nicht zurück.
Das AG gab der Klage auf Erstattung dieser Kosten sowie auf Übernahme der vorgerichtlichen Anwaltskosten weitestgehend statt. Das Gericht erklärte, dass der Anspruch des Fluggastes aus § 637 Abs. 3, Abs. 2, § 323 Bürgerliches Gesetzbuch besteht. Eine sonst übliche Fristsetzung war hierbei nicht nötig, da die Airline durch die eigenmächtige Änderung des Zielflughafens den Vertrag nicht erfüllt hatte. Der ursprünglich vereinbarte Zielort ist der zentrale Bestandteil des Flugvertrags, und die alternativlose Landung in Hannover stellte eine Leistungsverweigerung dar. Hinzu kam die erhebliche Verspätung von rund sechs Stunden. Der Fluggast durfte deshalb eigenständig moderate Kosten einsetzen, um den Zeitverlust zu verringern, wie etwa das Taxifahren nach Düsseldorf. Die Bahnkosten und die Taxikosten waren nachvollziehbar und erstattungsfähig, weil sie durch die vertragswidrige Änderung notwendig geworden waren.
Hinweis: Wer aufgrund einer Flugänderung zusätzlich reisen muss, kann Kosten für Bahn oder Taxi erstattet bekommen. Die Airline muss die vertraglich vereinbarte Leistung, insbesondere den Zielflughafen, einhalten. Fristsetzungen zur Ersatzbeförderung sind oft nicht erforderlich, wenn der Flugvertrag verletzt wurde.
Quelle: AG Düsseldorf, Urt. v. 07.07.2025 - 30 C 40/25(aus: Ausgabe 01/2026)
- Nutzlos aufgewendete Urlaubszeit? Kleinere Pannen und ungeplante Ereignisse vereiteln nicht gleich einen ganzen Segeltörn
Wenn einer eine Reise tut, kann er was erleben. Natürlich sind nicht gleich alle Erlebnisse auf Reisen erinnerungswürdig, dennoch sollte man es bei der Einforderung von Ersatzleistungen wegen Reisemängeln nicht übertreiben. Ob der Ersatz einer Monokielyacht durch einen Katamaran einen Mangel darstellt und in der Summe mit kleineren Unannehmlichkeiten eine Forderung weit über Reisepreis rechtfertigen kann, musste das Landgericht Frankfurt am Main (LG) bewerten.
Eine Familie hatte Anfang 2022 einen Segeltörn mit Skipper für April 2023 zu einem Gesamtpreis von rund 4.600 EUR gebucht. Die Route sollte kinderfreundlich sein und nur kurze Etappen von zwei bis drei Stunden beinhalten. Am ersten Tag bemerkten die Reisenden zahlreiche Defekte am ursprünglich vorgesehenen Monokielboot, die erst am nächsten Tag repariert werden konnten. Es kam zudem zu einer kleinen Kollision, weil der Skipper den Rückwärtsgang des Motors falsch einschätzte. Am 04.04.2023 erhielten die Reisenden schließlich einen Katamaran als Ersatz. Doch auch während der restlichen Reise gab es weitere Pannen, darunter ein Ausfall der Klimaanlage und zeitweise auch der Ausfall von Frischwasser. Die Familie forderte daher satte 14.000 EUR Schadensersatz, darunter auch fast 3.300 EUR für "nutzlos aufgewendete Urlaubszeit". Der Veranstalter bot hingegen erst nur 1.800 EUR, später sogar nur noch 1.300 EUR per Vergleich.
Vor dem LG ging es schließlich "nur" noch um 8.685 EUR. Und eben jenes Gericht entschied, dass die Familie lediglich Anspruch auf eine vergleichsweise geringe Rückerstattung des Reisepreises hatte. Zur Minderung berechtigte, dass das Boot am 03.04. erst gegen Mittag ablegen konnte und dadurch die Segelzeit verkürzt war, doch hierfür hielt das Gericht eine Minderung von 5 % des Tagesreisepreises für ausreichend. Ein weiterer Mangel war, dass vor Beginn des Törns keine Sicherheitseinweisung durch den Skipper erfolgte. Die Kollision schlug sich immerhin mit 80 % auf den Tagespreis nieder. Der Ausfall der Klimaanlage führte hingegen nur zu leichten Preisminderungen. Der Wechsel zu einem Katamaran stellte gar keinen Reisemangel dar, da vertraglich nur ein Segelboot vereinbart worden war, wozu sowohl Monokielyachten als auch Katamarane gehören. Der teilweise Ausfall des Generators gegen Ende der Reise hatte nach Ansicht des Gerichts ebenso keinerlei spürbare Auswirkungen auf das Segelerlebnis. Schließlich bewertete das Gericht die gesamten vorgetragenen Mängel als geringfügiger als die Reisenden und gewährte ihnen gerade einmal 962 EUR plus Zinsen und Anwaltskosten von 168 EUR - die restlichen 89 % der Kosten des Rechtsstreits hatte die Familie selbst zu tragen.
Hinweis: Ein Segeltörn gilt dann als mangelhaft, wenn Sicherheitsunterweisungen fehlen, das Ablegen verspätet ist oder wesentliche technische Defekte das Erlebnis beeinträchtigen. Der Typ des Segelboots allein begründet keinen Reisemangel. Schäden oder Störungen müssen die Nutzung der Reise tatsächlich einschränken, um Ersatzansprüche anmelden zu können.
Quelle: LG Frankfurt am Main, Urt. v. 20.08.2025 - 2-24 O 42/24(aus: Ausgabe 01/2026)